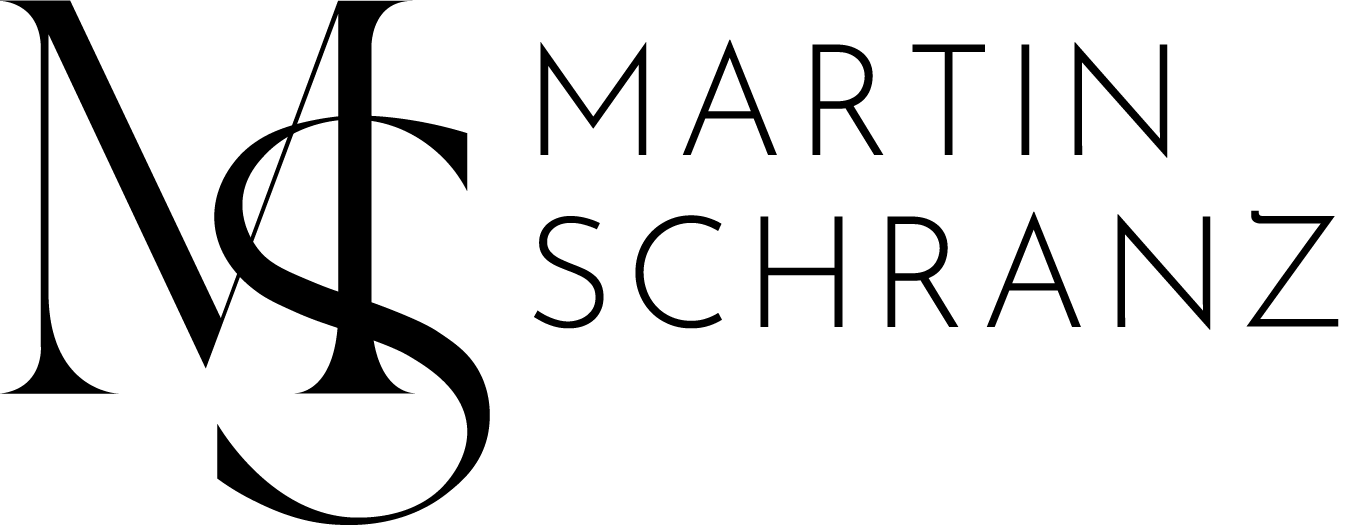Auf der Suche nach Glück auf dem Mt. Everest

Oft hat man mir die Frage gestellt: Warum geht man auf den Mt. Everest? Hast Du keine Angst, dabei zu sterben? Meine Antwort: Nein, ich habe viel mehr Angst davor, mein Leben nicht richtig gelebt zu haben!
Meine größte Angst war früher einmal, irgendwann einmal als alter Mann im Schaukelsessel zu sitzen und bereut zu haben, Dinge nicht gemacht zu haben, als die Gelegenheit dazu da war. Zu oft habe ich Menschen zugehört, wie sie sagten, dass sie dies und jenes im Leben verpasst haben, es bereuen und gerne noch einmal jung wären, um alles nachzuholen. Genau das gilt es für mich zu vermeiden – ich werde meine Zeit nutzen und keine Gelegenheit verstreichen lassen!
Im Prinzip bin ich auf der Suche nach Glück im Leben. Glück ist immer eine sehr flüchtige Angelegenheit, hält immer nur sehr kurz an und man weiß nie, wo es sich versteckt. Aus diesem Grund suche ich an jedem Ort der Welt nach einer weiteren Dosis Glück – und dieses mal ging es auf den höchsten Punkt der Erde, den Mt. Everest.
Muss man auf den Mt. Everest klettern, um Glück zu finden? Nein, muss man nicht. Ich habe nur irgendwann für mich entschieden, dass ich an so vielen Orten auf der Erde danach suchen werde, wie möglich. Es mag eine Sisyphus Aufgabe sein, aber man sollte wissen, dass Sisyphus bei dem, was er tat, glücklich war weil er seine Aufgabe – sein Ikigai – gefunden hat. (Ikigai kommt aus dem japanischen und steht für „das, wofür es sich lohnt zu leben“. ). Lass uns also schauen, ob ich fündig geworden bin…
Angefangen hat die Idee vom Mt. Everest etwa 50 Höhenmeter unter dem Gipfel des Aconcaguas, dem höchsten Berg von Südamerika in Argentinien. Am Ende des härtesten Abschnitts auf der Gletscherroute war ein Bergführer hinter uns, komplett am Ende seiner Kräfte. Als er zu uns aufschloss, legte er sich mit folgenden Worten neben uns in den Schnee: „Now you are ready for every 8k Peak.“ (Ihr seid jetzt bereit, jeden 8.000er zu besteigen). Gemeint waren damit der damalige Bergkamerad, mit dem ich inzwischen mehrere Abenteuer auf der ganzen Welt bestritten habe und eine gute Freundschaft daraus geworden ist. Dass wir 1,5 Jahre später zusammen mit demselben Bergführer auf dem Mt. Everest stehen würden, hätten wir zu dem Zeitpunkt allerdings nicht gedacht.
Trotzdem hat das Abenteuer kurz danach für mich angefangen. Die Idee war in den Kopf gepflanzt und es dauerte nicht lange, bis wir uns für das Abenteuer 1,5 Jahre Später angemeldet haben. Aber die Arbeit fing jetzt schon an – und zwar mit dem Training, denn eines ist klar: Es ist noch niemand vom Berg herunter gekommen der sagte, er hätte zu viel trainiert. Ausdauer und Kondition sind gefragt und je mehr man davon hat, desto eher schafft man nicht nur den Aufstieg, sondern auch die sichere Heimkehr.
Training und Ausdauer ist nicht alles aber wer das nicht mitbringt, hat es unnötig schwerer als jemand, der fit ist. Ich habe es vom ersten Tag an sehr ernst genommen. Bei jedem Training habe ich mir bewusst gemacht, dass ich mich für dieses Abenteuer in die beste Form meines Lebens bringen werde, und damit war der Weg das Ziel.
Zusammen mit einem Coach habe ich einen Trainingsplan ausgearbeitet und kann sagen, dass ich von über 400 intensiven Trainingseinheiten keine einzige ausgelassen habe. Es gab keine Entschuldigung, ein Training nicht zu absolvieren. Wichtig war dabei, dass ich mir keine Verletzungen zugezogen habe, indem ich von meinem Körper zu viel abverlangt hätte. Trainieren mit einem Coach hilft dabei ungemein.
Das meiste Training habe ich in im Freien absolviert, indem ich durch die Berge gelaufen bin. Mal schneller, mal langsamer und manchmal mit bis zu 20 Liter Wasser im Rucksack als Ballast. Es gab Trainings, in denen ich 30 km mit bis zu 3.000 Höhenmeter pro Tag absolvierte. Solche langen Einheiten waren am Anfang noch eine Herausforderung – später ging das recht einfach. Zusätzlich war ich auf Bergtouren mit Steigeisen, einer Expedition in der Antarktis und anderen Trainings das ganze Jahr über beschäftigt.
Es gibt kein spezielles Training für hohe Berge – es geht nur darum Ausdauer, Fitness und Erfahrung am Berg aufzubauen. Ich habe es für mich gemacht, hatte viel Spaß dabei und hatte immer mein großes Ziel vor Augen.
Im Nachhinein kann ich sagen, dass der Weg viel wichtiger war als das eigentliche Ziel. Das Ziel hat mir jedoch den Grund gegeben, den Weg zu gehen. Oft war das Training hart, kalt, nass, grausig und nicht selten habe ich mir selbst die Frage gestellt, warum ich mir das antue. Aber immer, wenn Zweifel aufkamen, hatte ich immer ein ganz klares Argument, welches ich als Kind immer zu hören bekam: „Wenn man etwas anfängt, bringt man es zu Ende.“ Aufgeben war also keine Option.
Über 1000 intensive Trainingsstunden später fühlte ich mich auch wirklich bereit. 2 Monate vor der Abreise fing ich auch noch mit der Vorakklimatisierung an, indem ich in einem Zelt übernachtete, indem der Sauerstoffgehalt immer weiter heruntergefahren wird. Schlafen in der Hypoxie. Ich hatte damit schon Erfahrung. Das Zelt stellte ich im Büro auf den Boden, wo ich dann die nächsten 2 Monate auch schlafen würde, um meinen Körper langsam an die großen Höhen in den Bergen zu gewöhnen.
Es ist ein recht großer Aufwand. Die Höhe am Berg ist aber das größte Risiko dem man dort begegnet und damit ist es für mich eine Frage der Sicherheit, meinen Körper so gut wie möglich darauf vorzubereiten. Diese Technik wird heute von sehr vielen Teams, die großen Wert auf Sicherheit legen, angewendet. Die Höhe ist ein unkalkulierbares Risiko, das man mit dieser Technologie enorm verringern kann. Es geht also nicht um Bequemlichkeit, sondern um Sicherheit. Profis und Puristen sehen das anders und das ist auch ok so – ich messe mich nicht mit ihnen.

Ich verbrachte also viele Nächste mit wenig Schlaf im Büro auf dem Boden im Zelt oder im Sessel im Zelt. Da der Kompressor (links im Hintergrund) recht laut brummte, konnte ich das Zelt nicht ins Schlafzimmer stellen. Meine Frau hätte dann 2 Monate auf dem Sofa im Wohnzimmer schlafen müssen und das wollte ich ihr nicht noch einmal antun (sie hat es schon einmal gemacht, als ich diese Prozedur für den Aconcagua 4 Wochen lang gemacht hab).
Manche Nächte waren gut, andere fühlten sich an, als wäre ich schon am Everest unterwegs. Kopfschmerzen und Kater, das Gefühl in dem Zelt zu ersticken und dann die Übelkeit – aber was tut man nicht alles, um den Spinner im Kopf zu befriedigen… 400 Stunden gehen auch irgendwann vorbei und somit habe ich es geduldig ertragen.
Den Mt. Everest kann man über mehrere Routen besteigen. Die bekannteste Route geht von Nepal aus durch den Khumbueisbruch über den Südsattel auf den Gipfel. Für mich kam diese Route nie in Frage. Ich wollte über die Nordroute von Tibet aus hinaufsteigen und habe mich bei einem erfahrenen Team angemeldet.
Die Nordroute ist technisch etwas anspruchsvoller und seit 2019 war kein westlicher Bergsteiger mehr auf dieser Route unterwegs. China hat den Berg erstmals 2024 für eine begrenzte Anzahl ausländischer Bergsteiger wieder geöffnet. Diese Chance musste ich nutze. Es war eine dieser Gelegenheiten im Leben, die man nutzen musste.
Zu den ganzen Vorbereitungen gehört auch die Auswahl der richtigen Ausrüstung. Es gibt genaue Ausrüstungslisten und somit ist es nur wichtig, dass man früh genug damit anfängt, die ganzen Ausrüstungsgegenstände zu organisieren und teilweise zu testen. Es wäre blöd, wenn der Schuh auf 7.500m anfängt zu drücken oder die coole Unterwäsche Nähte hat, die über mehrere Tage hinweg die Haut aufkratzt.
Man lernt auch, dass man alles festmachen muss – jede Trinkflasche am Körper muss mit Karabiner gesichert werden und auch sonst muss man sicherstellen, dass nichts davonfliegen kann und gleichzeitig griffbereit ist. All das sollte man sich vorher überlegen und ausführlich in der Wildnis draußen testen.
Ich denke dabei immer an eine Situation am Mt. Vinson in der Antarktis. Dort gab es einen ca. 600m hohen Abschnitt, wo es auf einer sehr steilen Schneefläche nach unten ging. Ich war der Erste ganz unten – nach mir kamen die anderen Teilnehmer. Was allerdings schneller unten war als die anderen Teilnehmer, waren deren Trinkflaschen, Helme, Handschuhe und Dinge, die sie nicht befestigt hatten – sogar eine Jacke kam auf einmal dahergeflogen – die Sachen konnte man anschließend unten wieder einsammeln. Am Everest gab es niemanden, der die Sachen unten einsammeln würde. Es macht also Sinn, sich mit solch logischen Kleinigkeiten auseinanderzusetzen, denn z.B. der Verlust der Sonnenbrille könnte einem den Tag ganz schön versauen und verhindern, dass man sein Glück findet.
Der Tag der Abreise war da und ich machte mich auf den Weg, der mich über Doha nach Kathmandu führte. In Doha traf ich die ersten Teilnehmer und meinen Kameraden.
Ich hatte noch keine E-Mails gelesen und kannte die News noch nicht. Es gab schlechte Nachrichten. China hat den Zugang zu Tibet immer noch nicht freigegeben und es war ungewiss, ob wir ein Visum bekommen würden. In dem Moment war das eine kleine Schocknachricht da wir ja schon unterwegs waren. Der Einsatz an Vorbereitung, Geld und Zeit war enorm groß und plötzlich war alles ungewiss.
Komischerweise war ich nicht traurig darüber oder gar enttäuscht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass alles richtig und gut sein wird.
In Kathmandu trafen wir viele andere Teammitglieder. Insgesamt sollten ca. 25 Teilnehmer über die Nordroute aufsteigen. Der Veranstalter hat ein Meeting einberufen und die Situation im Detail erklärt. Er erklärte ganz klar, dass es noch keine Visa gab und dass wenn keine Visa ausgestellt würden oder diese zu spät kommen würden, kein Aufstieg stattfinden würden und es keine Erstattung für die Kosten geben würde – immerhin hat jeder Teilnehmer bis zu 100.000,- EUR auf den Tisch gelegt!
Alternativ könnte sich jetzt aber jeder entscheiden, von Nepal aus aufzusteigen. Die Logistik dahinter ist gewaltig, weshalb sich jeder sofort entscheiden musste, ob man das Risiko eingehen würde oder ob man seine sichere Chance über Nepal wahrnehmen würde.
Es waren Leute dabei, die sich den Traum vom Everest mit einem Kredit finanzierten, andere, die Sponsoren hatten und wiederum andere, für die das Risiko einfach zu groß war. Alle entschieden sich für die „sichere“ Variante – also den Aufstieg von Nepal aus….
Außer ich und mein Kamerad, der mir versicherte, dass seine Entscheidung rein egoistisch war – so wie ich auch rein egoistisch entschieden habe. Der Veranstalter hatte noch 2 Teilnehmer aus einem anderen Team und damit genug Teilnehmer, um die Logistik für Tibet in Gang zu setzen. Die anderen beiden kamen von einem anderen Team, von dem sich auch alle für die Südseite entschieden haben. Da sie aber selbstständig unterwegs waren, hatten wir nicht viel mit ihnen zu tun.
Wir nahmen also das Risiko auf uns, dass es keine Visa geben wird und wir in 2 Wochen unverrichteter Dinge nach Hause fliegen würden – bekamen aber auch die Chance, ganz allein auf den Everest zu steigen.
Allein der Gedanke daran, dass seit der Kommerzialisierung vom Everest praktisch niemand mehr allein auf der Nordseite unterwegs war, war aufregend. Das sind Chancen, die man nur einmal im Leben bekommt und man mit keinem Geld der Welt kaufen kann. Genau mein Ding denn wenn sich auf dem Everest irgendwo etwas Glück befindet, gehört es uns allein!
Die Entscheidung war also getroffen und es wurde ein neuer Plan gemacht. Ob wir die Visa bekommen, würden wir in ca. 10 Tagen erfahren. Damit wir bis dahin weiter akklimatisiert bleiben, war der Plan, auf den Mera Peak aufzusteigen und 3 Nächte auf über 6.000m zu verbringen. Den Berg kannte ich schon und so war es angenehm zu wissen, was auf einen zukommt. Wir waren insgesamt eine Woche lang unterwegs, hatten gutes Wetter und eine gute Zeit am Berg.

Die extrem kalten und windigen Nächte gaben einem ein wenig das Gefühl, dass man in einem Abenteuer gelandet ist. Dass dabei schon die ersten zwei Mitglieder aufgeben mussten, zeigte, dass es kein Kinderspiel ist. Durchtrainierte Männer in bester Kondition mussten ausgeflogen werden – für sie war das Abenteuer an dieser Stelle schon zu Ende.
Nach dieser Tour am Mera Peak verabschiedeten wir die anderen Teammitglieder in Lukla, dem wohl gefährlichsten Flughafen der Erde und gleichzeitig Sprungbrett zum Everest. Während die andere Gruppe alle ins Everest Basislager gingen, erfuhren wir, dass wir das Visum zwar spät bekommen würden aber dass es wohl klappen würde. Wir flogen also nach Kathmandu ins Hotel und warteten. Es gab nichts zu jammern. Wir wohnten in einem Luxushotel mit Fitnessstudio und sehr gutem Essen. Es fehlte uns an nichts und kurz darauf erfuhren wir, dass es in 8 Tagen nach Tibet reisen würden.
Erst dachten wir drüber nach, noch mal nach Hause zu fliegen aber das Risiko, sich eine Erkältung oder C** zu holen war zu groß. Es gab auch kurz die Idee, die Ama Dablam zu besteigen, was ein ikonischer Berg in der Khumbu Region ist. Aber auch die Idee mussten wir ablegen da das Wetter nicht stabil genug war. Später erfuhren wir, dass es ein schweizer Team versuchte und den Aufstieg wegen starkem Wind nicht schaffte.
Wir waren also in Kathmandu im Luxushotel. Wunderbar – also machten wir uns ein Programm. Jeden Tag traf man sich zum Frühstück, dann zum Training im Fitnessstudio wo u.a. auch einmal das schweizer Fernsehen dabei war um uns zu filmen. Am Nachmittag machten wir ab und zu ein kleines Touristenprogramm und manchmal nichts um dann am Abend zu überlegen, was wir essen wollten.
Wir hatten es echt fein im Gegensatz zu den anderen Teilnehmern. Oben im Basislager war das Wetter schlecht, es schneite, war kalt und es gab kein Wetterfenster für einen Aufstieg. Man konnte nur ausharren und warten. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass die Tage in den Zelten lang sind, wenn man nichts zu tun hat – vor allem, wenn es ungewiss ist, wie lange man festsitzen würde.
Die Woche ging für uns schnell vorbei, wir waren gut erholt und dann ging es nach Tibet. Es war der erste Flug seit Jahren von Kathmandu nach Lhasa, wo wir an einem riesigen, hochmodernen Flughafen landeten, an dem es jedoch keinen Flugbetrieb gab.
Erstaunlich, wie uns viel mehr Zollbeamte und Polizisten empfangen haben, als Gäste im Flugzeug waren. Wir wurden von einem großen Komitee freundlichst empfangen und fuhren gleich weiter ins ca. 4 Stunden entfernte Xigaze, wo wir eine Nacht im Hotel verbrachten. Das Tibetische Hochland ist auf über 4.000m und so finden sich im Hotelzimmer neben dem Bett Sauerstoffmasken für Touristen, die noch nicht an die Höhe angepasst sind.
Am nächsten Tag ging es direkt weiter ins Basislager, wo man auch den Everest das erste mal sehen kann – und Respekt bekommt. Bilder können das nicht zeigen – dieser Berg ist so gewaltig groß und egal wie groß die Klappe von jemand ist: Wer davor steht wird erst einmal leise!

Unser Team von Sherpas war schon einige Stunden hier und hat das Basislager aufgebaut. Es war viel luxuriöser als erwartet und versprochen. Der Veranstalter und das Team haben in der Tat rund um die Uhr gearbeitet, um alles ordentlich vorzubereiten. Ich war wirklich beeindruckt. Jeder hatte ein eigenes großes Zelt, das Essen war hervorragend und am 2. Tag stand sogar ein Dom als Aufenthaltsraum für uns bereit.
Das Wetter war nach wie vor schlecht am Berg. Die Teams im Süden saßen immer noch im Basislager fest und es zeichnete sich ab, dass das Wetter in einer Woche stabil werden würde, was für uns beinahe perfekt war. In einer Woche konnte das Team die oberen Lager vorbereiten und wir konnten die Zeit noch nutzen, um uns weiter zu akklimatisieren. Wir unternahmen einige Touren auf über 6.000m und merkten, dass wir fit und sehr gut akklimatisiert waren.
Im Lager gab es immer wieder Aktivitäten. So war es ein großes Spektakel, als sich die ganzen Yacks mit über 1.500kg Material in Bewegung setzten, um die oberen Lager einzurichten. Es ist eine unglaubliche logistische Meisterleistung, wenn man bedenkt, dass eigentlich nur ein paar Bergsteiger und Bergführer mit ihren Sherpas unterwegs waren. So viel Material für ein paar Tage am Berg – unglaublich und faszinierend zugleich!

Ein weiteres Highlight war die Puja, wo ein Mönch vom Nahegelegenen Kloster über Stunden hinweg Gebete singt, bei denen die Ausrüstung gesegnet wird und anschließend gefeiert wird. Ohne diese Zeremonie würde kein Sherpa den Berg betreten.

Das Sherpa Team ging 3 Tage vor uns los und wir hatten nun unser Wetterfenster. Zu unserem Glück kam dieses Wetterfenster in diesem Jahr sehr viel später als in den Jahren zuvor. Was für uns ein Vorteil war, war für die Teams auf der Südseite nicht so toll. Sie saßen insgesamt 2 Wochen lang im Basislager fest. Während wir in bequemen Hotels übernachteten, verbrachten sie ihre Zeit im Zelt, in großer Höhe in bitterer Kälte und somit ohne richtige Erholung. So gesehen hatten wir es schon sehr viel schöner.
Das Wetter war in dem Wetterfenster für mehrere Tage sehr gut. Den ersten Tag reservierte das chinesische Team für sich, was uns einen weiteren Ruhetag im Advanced Basecamp, unter dem Nordsattel einbrachte. Der Berg wurde für uns am Tag danach geöffnet und es stellte sich heraus, dass unsere kleine Gruppe das einzige Team am ganzen Berg sein wird. Ich hatte innerlich ein Lächeln bis weit hinter die Ohren – so ein Glück muss man auch erst mal haben!
Das Basecamp ist auf 5.400m und man kann noch recht gut schlafen. Das Intermediate Basecamp ist schon auf 6.000m auf einer Geröllhalde. Die Zelte stehen auf unbequem großen Steinen und zwischen den Zelten laufen die ganze Nacht die Yacks mit ihren Glocken herum. Obwohl ich immer Ohrstöpsel in den Ohren hatte, war der Schlaf hier schon sehr dünn. Das Advanced Basecamp ist dann schon auf ca. 6.400m und damit so hoch wie der Gipfel des Mera Peaks. Es befindet sich unter dem Nordsattel auf einer Geröllhalde neben dem Gletscher.
Hier bewegt man sich nur noch sehr langsam. Jeder Schritt ist anstrengend und man ist mit jeder Bewegung immer sofort außer Atem. Alles ist äußerst anstrengend und man sollte mit seiner Energie haushalten. Wer sich in dieser Höhe zu sehr verausgabt, wird sich nie wieder erholen. Der Hunger lässt stark nach und man muss sich zu jedem Bissen Essen zwingen. Etwas, das unter normalen Umständen nur „nicht gut schmeckt“, würde man hier oben sofort wieder herauswürgen.
Trotzdem sollte man so viel Kalorien wie möglich verzehren da der Körper in der Höhe bis zu 10.000 Kalorien pro Tag verbraucht. Isst man nicht genug, frisst sich der Körper praktisch selber auf – man verliert schnell an wichtiger Muskelmasse und wird schwach.
Ich tat mir am leichtesten mit Snickers, Porige, Eier und Energieriegel. Was gar nicht ging und nur einen Würgereiz verursachte, waren Nudeln, die auf der Höhe in Wasser gekocht wurden – Wasser das bei so geringem Luftdruck schon bei 85 Grad kochte – entsprechend lang mussten Nudeln gekocht werden und so haben sie auch geschmeckt. Unmöglich, das zu essen. Ansonsten war das Essen auch im Advanced Basecamp sehr gut.
Vom Advanced Basecamp geht es dann in die letzten 3 Etappen, wobei die erste Etappe schon sehr anstrengend ist. Der Aufstieg auf den Nordsattel zieht sich über mehrere Stunden in einer steilen Eiswand, wobei es auf 7.000m hinauf geht und nach oben hin immer steiler wird.

Es war nur gut, dass niemand am Berg war, denn wenn in diesen steilen Wänden der Gegenverkehr abseilen wollte, hätte eine Partei immer sehr lange warten müssen, bis die Andere fertig wäre. Uns ist das zum Glück komplett erspart geblieben. Wir waren alleine unterwegs.
Auf dem Nordsattel bekommt man dann einen unglaublich schönen Ausblick über das Tal und die Umliegenden Berge. Man kann nicht fassen, dass man schon auf 7000m ist, da man immer noch zwischen gewaltig großen Bergen steht und das eigentliche Ziel immer noch 1850 Höhenmeter weit entfernt ist.

Die Nacht verbrachten wir mit etwas Sauerstoff. Erst konnte ich mir nicht vorstellen, dass man mit so einer Maske im Gesicht überhaupt schlafen kann, aber ich wurde schnell eines Besseren belehrt. Fast 9 Stunden konnte ich durchschlafen wie ein Baby. Ich wachte nur ein paarmal auf, um das Kondenswasser aus der Maske zu leeren, konnte dann aber gleich wieder einschlafen und war am Morgen wieder top fit. Es fühlte sich super an, so gut ausgeschlafen zu sein, wenn man so einen Aufstieg vor sich hatte.
Um 10 Uhr starteten wir zur nächsten Etappe. Vom Nordsattel auf das 2. Hochlager auf 7.600m über ein unendlich langes, steiles Schneefeld. Stunde um Stunde machte man einen kleinen Schritt nach dem anderen und während die Landschaft hinter einem immer kleiner wurde, wurde sie vorne immer größer. Die Wahrnehmung verzerrte sich wegen dem geringen Sauerstoffgehalt und die Welt wird immer kleiner.
Man hat nur noch den nächsten Schritt vor sich im Blickfeld und versucht zu vermeiden, dauernd zu schauen, ob man schon weitergekommen ist. Man bewegt sich quälend langsam mit einer extrem trockenen Kehle, die bei jedem Schlucken schmerzt. Man hyperventiliert und der Puls ist immer weit über 160-175, ohne dass man sich schnell bewegt. Es ist der Normalzustand und während ich noch dachte, dass das Training hart war, bei dem ich mich in dem Pulsbereich bewegte, lernte ich hier, dass das Training im Vergleich dazu eher ein Wellnessurlaub war.
Unserem Bergführer spielte die Verdauung verrückt und ein Sherpa musste sich dauernd übergeben. Sie hatten knapp 30kg in ihren Rucksäcken, die sie an der Stirn trugen, was langfristig effizienter und gesünder ist, wenn man große Lasten trägt. Unglaublich, was diese Helden hier leisten. Sie waren nur unwesentlich langsamer als wir mit fast leeren Rucksäcken untergwegs.
Nach ca. 7 Stunden kommt man bei den Felsen an und kann über sich auf einigen Felsvorsprüngen schon Zelte sehen. Man denkt, dass man sicher gleich da sein müsste – die Zelte sind ja ganz nahe – aber es täuscht. Weitere 2 Stunden braucht man durch die Felsen hinauf bis zum Lager auf 7.600m.

Die Zelte werden hier auf kleine Plateaus gebaut. Es ist sehr eng im Zelt und der Boden sehr uneben und es ist äußerst unbequem hier zu campieren. Wir hatten den Sauerstoff zwar immer griffbereit – trotzdem ging ich ohne Maske etwas raus um Bilder zu machen.

Es ist unbeschreiblich schön und gleichzeitig unvorstellbar anstrengend nur aufzustehen und ein paar Bilder zu machen. Man hat dauernd das Gefühl zu ersticken und egal wie heftig man atmet, reicht der Sauerstoff nie richtig aus. 20m weit zum Nebenzelt gehen, um etwas Tee abzuholen, entwickelt sich schnell zu einer Aufgabe, die eine halbe Stunde lang dauern kann und man fühlt sich so unglaublich schwach.
Das Gute ist aber, dass man sich durch den Mangel an Sauerstoff, gar nicht so viele Gedanken machen kann. Man denkt so langsam, dass man sich aufs Wesentliche konzentriert, viel trinkt, etwas essen und vielleicht noch versucht, den Moment etwas zu genießen. Wir hatten beste Aussicht in einer unglaublichen Landschaft. Wir waren schon über den Wolken und der Sonnenuntergang brachte ein einzigartiges Farbenspiel mit sich. Es sind diese kleinen Momente, die das Erlebnis so außergewöhnlich machen und ich denke, dass es sich dafür lohnt, die Strapazen auf sich zu nehmen. Es gibt hier kurze Momente von Glück und Zufriedenheit, bevor man wieder von der Realität eingeholt wird – denn man befindet sich hier knapp unter der Todeszone und es wird bald Nacht.
Die Nacht auf 7.600m mit Sauerstoff war eigentlich ok. Ich denke, ich habe etwas über 4 Stunden Schlaf abbekommen und war am Morgen bereit für die nächste Etappe auf den höchsten Campingplatz der Erde auf 8.300m. Der Aufstieg war körperlich enorm anstrengend und die Wahrnehmung verzerrte sich immer mehr. Hier kurz ein Beispiel:
Kurz über dem Lager kommt man auf ein ca. 100m langes Schneefeld, auf dem man auch die 8.000m Grenze überschreitet. Ein Bergführer und mein Kamerad waren mir etwa 100m voraus, schon am Ende von dem Schneefeln und hinter mir war niemand. Ich ging an 2 Sherpas vorbei, die noch eine Pause machten und war allein auf diesem Schneefeld.
Kurz darauf erlebte ich einen schockierenden Moment. Ich schaute nur vor mich in den Schnee, konzentrierte mich auf den nächsten Schritt und das Atmen, um einen Rhythmus zu finden. Ich war ganz im Moment gefangen und setzte einen Fuß vor den nächsten. Gefühlt war ich schon sehr lange unterwegs und dachte mir, dass ich einmal aufschauen sollte, wie weit ich schon gekommen bin. Ich war der Meinung, schon eine ordentliche Strecke zurück gelegt zu haben – und da bin ich erschrocken.
Gefühlt war ich am Ende vom Schneefeld und ich war mir sicher, dass ich locker schon 80m der 100m zurückgelegt hatte. Ich war gefühlt seit einer Ewigkeit unterwegs… dachte ich mir. Die beiden Sherpas, die Pause machten, waren ca. 6-8m hinter mir und das ganze Schneefeld noch vor mir. Obwohl ich dachte, ich wäre ewig weit gelaufen, brachte ich keine 10m hinter mich. „Das wird wohl ein langer Tag werden“… dachte ich mir.
An die folgenden Passagen durch die Geröllhalde und die Felsen kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Es geht über Stunden dahin, man bewegt sich langsam und ich war allein, konnte meine Pace gehen und so setzte ich ein Bein vor das Nächste. Das Wetter wurde etwas schlechter, Schneefall setzte ein, aber irgendwann sah man wieder die Zelte, die so nahe zu sein schienen und doch so fern waren.
Vom Moment, wo man das Lager sehen konnte, bis man dort ankam, vergingen wieder fast 2 Stunden, in denen man sich jeden einzelnen Schritt hart erkämpfen musste. Der Puls ist hier stundenlang im oberen Bereich – bei mir über 160 und teilweise über 170. Sportler wissen, dass es anstrengend sein kann, sich über 8 Stunden lang in den Pulszonen 3 und 4 zu bewegen.
In der Höhe ist der Puls immer in dem Bereich, sobald man sich etwas bewegt und man kann zwar Zucker in Form von Schokolade, Powergels und Energieriegel aufladen, aber Koffein ist hier oben keine gute Idee mehr. Powergels sind hilfreich und man verwendet sie – jedoch ohne den Energieschub von Koffein. Ich habe davon irrsinnige Kopfschmerzen und Kater bekommen, weshalb ich es gelassen hab.
Das Einzige, was man tun kann, ist gelegentlich ein Schluck Tee zu trinken, ab und zu mit etwas Powergel nachzuhelfen und langsam bewegen. Wir waren hier schon mit 2 Liter Sauerstoff pro Minute unterwegs und ehrlich gesagt, ich konnte mir nicht mehr vorstellen, mich hier oben ohne Maske zu bewegen. Die Luft ist einfach so dünn, dass man die Luft nicht mehr spürt, die man einatmet. Bergsteiger, die hier herauf ohne Maske gehen, sind unglaublich stark und bereit, ein großes Risiko einzugehen.
Die Diskussion, ob man mit oder ohne Sauerstoff auf so einen Berg geht, ist für mich schnell erledigt. Profis haben ihre Argumente und Leute, die am Sofa zu Hause sitzen, wissen natürlich alles sehr viel besser aber wer halbwegs sicher wieder zu seiner Familie nach Hause kommen will, geht hier her nicht mehr ohne Maske.
Wer sich, oder wem anderen was beweisen will, soll es probieren aber die Wahrscheinlichkeit dabei zu sterben ist einfach 26x höher. Der Luftdruck und damit der Sauerstoffgehalt nehmen in der Höhe exponentiell ab. Alles über 8.000m ist nicht mehr gemacht, um längere Zeit zu überleben. Kein Lebewesen auf Erden gehört hier hin – und das spürt man auch! 6 der 8 Todesopfer am Everest in dieser Saison waren ohne Sauerstoff unterwegs. Sie starben alle in den 4 Tagen, an denen wir am Berg unterwegs waren. Der Mensch ist schlichtweg nicht dazu gemacht, hier oben zu überleben!
Im 3. Hochlager auf 8.300m, was auch der höchstgelegene Campingplatz der Welt ist und höher gelegen ist als die meisten 8.000er dieser Erde, verbringt man nicht viel Zeit. Man kommt am späten Nachmittag an, versucht etwas zu essen, so gut wie möglich zu trinken und ruht sich aus, denn um 22 Uhr geht es los.

Bis dahin liegt man im Zelt, versucht etwas zu ruhen weil an Schlaf nicht zu denken ist. Man ist schwach, fühlt sich schlecht und das Hirn funktioniert nur noch sehr langsam. Man muss bei Tageslicht alles vorbereitet haben, was man braucht – alles muss an der richtigen Stelle griffbereit sein, denn jede Bewegung ist äußerst mühsam. Alles ist klobig und mit der Sauerstoffmaske im Gesicht ist das Blickfeld massiv eingeschränkt. Nimmt man die Maske herunter raubt einem die kleinste Anstrengung, wie z.B. aufsitzen und etwas essen, den Atem und man hyperventiliert sofort.
Und plötzlich ist man wieder in dieser komplett anderen Situation. Extreme Kälte, Dunkelheit, Verpackt in Anzug und Maske, unmöglich zu kommunizieren und im Stress, weil man nichts vergessen darf. Die Sauerstoffsättigung im Blut liegt nur noch um die 70%. Würde ein Patient in einem Krankenhaus mit solch einer Sauerstoffsättigung eingeliefert werden, wäre das ein akuter Notfall. Der Körper kann kaum mehr eigene Wärme produzieren und vor allem kann der Kopf nicht mehr richtig denken. Allein zu entscheiden, welcher Schuh an welches Bein gehört oder wie man Steigeisen anzieht, fordert schon fast das Maximum an Denkvermögen.
Wer nicht schon alles am Tag vorbereitet hat, wird in der Dunkelheit, der Kälte und der wirklich widrigen Situation kaum mehr in der Lage sein, seine Sachen ordentlich zu packen. Obwohl man nicht viel mitnimmt, muss man doch gut organisiert sein. Man muss alles Griffbereit haben, weil man den Rucksack nicht bei jeder Gelegenheit herunternehmen kann – es ist einfach zu mühsam. Eine Kleine Trinkflasche an der Brust, Ersatzhandschuhe im Rucksack, Powergel und Hafer Riegel griffbereit, Skibrille wenn es windig wird oder die Sonne aufgeht, Handy für Bilder und so weiter…. alles muss griffbereit sein und gleichzeitig darf es nicht verloren gehen.
Ich dachte immer an die Sherpas, die jetzt an alles denken mussten. Sie mussten im Überblick behalten, welche Sauerstofflaschen sie mitnehmen würden, wie viele sie mitnehmen würden, wo sie Sauerstoffdepots auf dem Weg einrichten würden… um nur ein Detail zu nennen. Gleichzeitig mussten sie uns im Auge behalten… und so weiter.
Unser kleines Team war aber sehr stark. Jeder konnte selbstständig aufsteigen, brauchte keine direkte Hilfe der Sherpas und so waren wir zügig unterwegs, wenn man das Wort zügig verwenden kann. Man bewegt sich mit 0,3 bis 0,5 km/h vorwärts. Schneller geht es nicht voran.
Als erstes quert man ein Schneefeld und dann steht man vor der Felswand zum Sattel hinauf. Es ist im Grunde leichtes, technisches klettern – nur in der Höhe wurde jeder große Schritt, jeder Zug und jede kleine Passage zu einer riesigen Herausforderung. In meiner Heimat würde ich dem Gelände locker ohne Seil klettern, aber hier fühlte es plötzlich nach einem oberen Schwierigkeitsgrad an.
Der dicke Daunenanzug und die klobigen Schuhe machten es nicht leichter – man kann seine Füße nicht wirklich sehen, muss jeden Klettertritt praktisch ertasten und man hat immer im Hinterkopf, dass wenn hier etwas passiert, keiner mehr helfen kann. Bricht man sich hier das Bein, kann man sich im Prinzip zum Sterben hinsetzen. So krass das klingt, aber es ist tatsächlich so, dass hier oben keine Hilfe möglich ist, wenn man nicht selbstständig wieder hinunterkommt.
Man bewegt sich also mit einer enormen Übervorsicht voran und hat wenig Zeit, in die Landschaft zu schauen. Es war eine klare Nacht, wenig Wind und damit machte auch die extreme Kälte nicht so viel aus – es war eine traumhafte Nacht und als wir am Grat ankamen, eröffnete sich uns ein gewaltiger Ausblick auf die vom Vollmond beleuchtete Landschaft. Die Schneekristalle glitzerten in der Luft und der Mond stand genau über dem Gipfel des Mt. Everest.

Wie beim ganzen Aufstieg trüben hier oben die Sinne. Sieht der Grat von unten recht flach aus, erscheint von hier aus alles wie ein gewaltig steiler Aufstieg und der Gipfel scheint in sehr weiter – schier unerreichbarer Ferne. Bis zum sogenannten 1st Step habe ich wieder sehr wenige Erinnerungen. Der 1st Step ist eine kleine Kletterpassage. Es war alles mit Seilen gesichert aber ein Blick nach unten verriet mir, dass ich in diese Seile lieber nicht hineinfallen möchte. Wegen der klaren Nacht sah man rechts von sich 3.000m in die Tiefe und während man in dem Felsen kletterte, fühlte es sich an, als würde es direkt unter seinen Beinen 3.000m senkrecht in die Tiefe gehen. Das war nicht so – es hat sich aber so angefühlt. Es war allerdings auch kein Gelände, in das ich hineinfallen hätte wollen.
Danach geht es weiter. Meiner Meinung nach hatten wir gute Bedingungen, da es geschneit hat, weil es mit Steigeisen angenehmer ist, auf Schnee zu laufen als auf Felsen. Der Bergführer meinte aber, dass es ohne Schnee einfacher wäre, weil man sehen kann, wo man hintritt. Ich kanns nicht sagen – fand aber, dass die Bedingungen sehr gut waren.
Irgendwann steht man dann vor dem 2nd Step – dem berühmten Felsen, in den 2 Leitern eingehängt wurde, um die Stelle zu bewältigen. Hier spielten meine Sinne wieder verrückt. Dieser ca. 40m hohe Felsen wirkte so gewaltig groß, dass ich dachte, wir stehen schon unter dem Gipfel und gleichzeitig dachte ich, dass dieser Gipfel noch so groß und weit entfernt ist, dass ich Gedanken ans Aufgeben hatte.
Mein Sherpa war mir aber immer dicht auf den Fersen und vor mir waren die anderen, an denen ich dranbleiben wollte. Es war trotzdem ein spezielles Gefühl über diese Passage zu klettern, von der man schon so viel gehört hat und nun setzte ich meine Füße auf diese Passage, klippte meinen Karabiner ein, und kletterte diese Leiter hinauf. Oben angekommen musste man noch über einen kleinen Felsen drüber. Auch hier war die Schwierigkeit, dass man seine Beine nicht sehen konnte, aber es ging einwandfrei. Mein einziger Gedanke war dann nur noch: Wie kommt man hier wieder hinunter?
Nach diesen paar herausfordernden Passagen hatte ich eine Zeit lang keine Angst mehr, aufzusteigen sondern nur noch die Frage im Kopf, wie wir da wohl wieder runterkommen würden. Unterbrochen wurden die Gedanken dann vom 3rd Step, der allerdings nicht schwer zu bewältigen war. Wahrscheinlich ist die Stelle ohne Schnee schwieriger zu bewältigen aber dank dem Schnee waren Tritte einfach zu finden.
Danach dachte ich, dass die letzten 100 Höhenmeter ein Spaziergang über ein Schneefeld und den Gipfelgrat wären – die Freude war aber zu früh, denn nach der Querung des sogenannten Gipfeldreiecks querte man weiter, bis man fast bei einer Felswand ankommt, die wiederum gigantisch groß wirkt.
Von hier aus ist wieder Klettern angesagt. Man ist inzwischen auf knapp 8.800m angekommen und jeder Schritt, jeder Tritt und jede Bewegung wird hier oben unglaublich anstrengend. Auch diese Kletterpassage würde ich in den Alpen ohne Seil klettern – hier oben bewegte ich mich körperlich und psychisch an meinem Limit.
Wann immer ich Zeit hatte, schaute ich hinunter und dachte mir nur: Wenn wir das alles abseilen müssen, wird das ein sehr langer Tag… mir graute es davor aber davonlaufen konnte ich genau so wenig wie in den Schnee sitzen und trotzig werden. Man sollte immer im Kopf behalten: „Der Gipfel ist eine Option, der sichere Abstieg eine Pflicht!“ Selbst 50 Meter unter dem Gipfel aufzugeben ist keine Schande wenn man sich nicht sicher ist, auch wieder sicher absteigen zu können.
Genau das macht ein Abenteuer eigentlich auch aus. Man bringt sich selbst in eine äußerst unangenehme Situation bis an seine persönlichen Grenzen, meistert die Herausforderungen und bringt sich wieder aus der Situation heraus. Je extremer das ist und je größer der Aufwand und das Abenteuer ist, desto intensiver fühlt es sich an. Man wünscht sich nur noch aus dieser Situation rauszukommen, schwört sich, nie wieder so etwas zu machen und wenn alles gut gegangen ist… na ja… dann findet man halt wieder was Neues.
Wir kletterten konzentriert weiter hinauf und auf einmal waren wir auf dem Gipfelgrat. Es war der perfekte Moment. Vor uns ging der Mond unter, hinter uns ging die Sonne auf. Wir erlebten ein unglaublich schönes Farbenspiel über den Wolken. Es war der perfekte Moment, um diesen Punkt zu erreichen. Wir konnten den Schatten des Everests in Form einer Pyramide sehen und genau dahinter den Mond und der Gipfel war keine 20 Minuten mehr entfernt.

Hier hatte ich meinen emotionalen Moment, den ich genießen konnte, weil es keine Eile mehr gab. Es war der Moment, wo ich wusste, dass ich es schaffen werde, und ich fühlte mich stark genug um zu wissen, dass wir es auch vernünftig wieder hinunter schaffen würden. Es war ein Moment der Freude und ein Moment von Stolz, dass ich es geschafft hatte …. und ich fand einen Moment von purem Glück mit einer Freudenträne in meinen Augen. Es war also hier… ein Stück von meinem Glück – der Aufwand hatte sich gelohnt, auch wenn der Moment nur kurz angehalten hat.
Am Gipfel selbst war viel los. Wir trafen auf Teams von der anderen Seite und es gab keinen Moment der Ruhe mehr. Ich schaute mich um, versuchte den Moment zu genießen und machte ein paar Bilder. Ich brachte auch ein Armband, das meine Tochter selbst hergestellt hatte, am Gipfel an einem Pfosten an. Damit kann Sie mit Stolz behaupten, dass ihr Handwerk sogar am Gipfel des Everests zu ausgestellt wird.
Ich machte auch noch Bilder von einer Uhr mit ihrem Zertifikat, die ich später in einer Benefizauktion versteigerte. Es war eine Rolex Explorer. Der Erstbesteiger des Mt. Everest, Edmond Hillary, trug auch eine Rolex Explorer, als er den Gipfel erreichte. Somit hat diese Uhr eine einzigartige Geschichte und wird damit einem guten Zweck zugutekommen. Mit dem Erlös kann die Schulbildung von 100 Kindern über 5 Jahre gesichert werden und gibt damit 100 Kindern eine Chance, etwas aus ihrem Leben zu machen. Mehr darüber findest Du auf der Webseite meiner Stiftung, www.myidol.com
Wir gingen nach ca. 20 Minuten wieder weg vom Gipfel. Einige Meter weiter unten sammelte ich noch einen Stein und wir gingen über den Grat zurück an die Stelle, wo es über die Felsen hinunter ging.
Nun hatten wir einen Vorteil, der ab jetzt alles enorm vereinfachen würde. Da wir als kleine Gruppe schnell unterwegs waren bzw. keinen Sauerstoff mit langen Wartezeiten an den Schlüsselstellen verbrauchten, hatten wir sehr viel Reserve in den Flaschen.
Viel Sauerstoff in der Höhe bedeutet, dass man auch mehr Kraft hat. Mehr Kraft bedeutet, dass man diese Passagen durch die Felsen nicht mühsam einzeln abseilen musste, sondern einfach den Sauerstoff aufdrehte, sofort mehr Kraft hatte und somit konnte jeder in Selbstsicherung absteigen. Wir mussten uns nicht einmal mehr beeilen, sondern konnten in Ruhe absteigen.
Es gab keine Wartezeiten, weil einer nach dem anderen einfach in Selbstsicherung an den Seilen hinunter klettern konnte. Dazu drehte man einfach den Sauerstoff auf 3-4 Liter pro Minute auf, spürte sofort, wie das Leben und die Kraft in den Körper zurückkam und damit konnte man sich selbst sichern und es ging echt zügig voran.
Auch die Schlüsselstelle am 2nd Step war zwar anspruchsvoll, aber jeder konnte selbstständig absteigen und damit ging es sehr ohne Wartezeiten. Die Kehle war trocken und tat weh, man wurde immer schwächer und jede Bewegung tat weh, aber ich muss ehrlich sein: Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt.

Morgens um 9 Uhr waren wir schon im 3. Hochlager, wo wir uns kurz hinsetzten, etwas Tee tranken und eine halbe Stunde rasteten. Der Grad an Erschöpfung ist erstaunlich und ich lernte hier oben, meine Grenzen weit nach vorne zu verschieben – ich hatte ja keine Ahnung, zu was ein Mensch fähig sein kann, wenn es keine andere Option gibt.
Wir tranken unseren Tee, etwas Powergel dazu und nach einer halben Stunde schafften wir es wieder auf die Beine. Das Ziel war es, noch vor der Dunkelheit wieder unten im Lager anzukommen. Wir hatten also noch 10 Stunden Zeit.
10 Stunden Abstieg, nachdem man so einen Aufstieg hinter sich hat – und man jetzt schon kaum mehr auf die Beine kommt, nachdem man sich hingesetzt hat?
Wieder hatte ich die Worte im Kopf: Das wird wohl ein langer Tag…
Die Sherpas blieben hinter uns. Sie räumten das Lager auf und hier passierte mir dann ein Fehler, den ich bereuen würde. Ich hatte fast nichts mehr zu trinken und dachte, wir würden im nächsten Lager wieder Pause machen und Eis schmelzen. Ich trank hier oben den letzten Schluck, den ich hatte und ab jetzt war ich dann durstig.
Wir machten im 2. Hochlager keine Pause, sondern stiegen weiter ab. Jeder Schritt schmerzte in den Knien wie Nadelstiche und ich wurde langsamer. Wir waren zu viert und ich war der letzte. Ich fiel etwas zurück, aber ich machte einen Schritt nach dem Anderen nach vorne. Mein Hals war so unglaublich trocken und ich machte, was man nicht tun sollte – ich musste etwas Schnee in den Mund nehmen, damit dieser etwas feucht wurde.
Die anderen hatten auch fast nichts mehr zu trinken dabei, weshalb ich nicht schnorren wollte und ich wollte auch nicht zugeben, dass ich zu wenig zu trinken dabeihatte. Irrational und nicht schlau aber das Hirn funktioniert da oben nicht wie gewohnt. Ich sagte also nichts und durstete weiter.
Stunde um Stunde ging es abwärts und das Schneefeld über dem Nordsattel, das beim Aufstieg schon lange erschien, erschien jetzt im Abstieg noch viel länger. Hätte ich die Wahl gehabt, gefoltert zu werden oder weiter abzusteigen, hätte ich jede Form der Folter vorgezogen. Ich war so unglaublich müde und erschöpft wie ich es noch nie im Leben zuvor war.
Je weiter wir herunterkamen, desto wärmer wurde es und man konnte den Daunenanzug nicht ausziehen – zum enormen Durst und dass ich ohnehin schon extrem dehydriert war, fing ich zu allem Überfluss noch an zu schwitzen. Damit wurde ich immer noch schwächer. Das Blut in meinen Adern war vermutlich nur noch eine zähflüssige Masse die sich kaum mehr bewegte (das ist jetzt übertrieben – es hat sich aber so angefühlt).
Kurz bevor man am Nordsattel ankam, musste man noch einmal ca. 15 Höhenmeter aufsteigen, um ihn zu queren und dahinter dann abzusteigen. Diese 15 Höhenmeter waren mein sogenannter „Heartbreak Hill“ – an dem Punkt bin ich dann beinahe zerbrochen. Es war der Punkt, an dem ich glaubte, aufzugeben, hinzusitzen und auf bessere Zeiten zu warten. Dieser kleine Aufstieg machte mich fertig und ich war den Tränen nahe – noch nie im Leben war ich so fertig, wie in diesem Moment. Ich schaffte es kaum mehr, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Es tat so weh und ich konnte nicht mehr. Die Gruppe war etwa 20m vor mir und ich wollte mir nichts anmerken lassen – also nahm ich wieder etwas Schnee in den Mund, und setzte einen Fuß vor den Anderen in einer Zeitlupe die den Anstieg zu einer langen Tortour machte.
Bevor wir uns die steilen Wände vom Nordsattel abseilten, machten wir noch kurz Pause. In meiner Trinkflasche taute ein kleiner Schluck Wasser auf, der davor noch Eis war – dieser Schluck fühlte sich an, wie ein Lebensretter.
Das Abseilen war mit den dünnen, nassen und vereisten Seilen keine Freude, aber wir hatten auch hier das Glück, die Einzigen am Berg zu sein. Nicht auszudenken, was hier los ist, wenn hier mehrere Gruppen gleichzeitig rauf und runter wollen. Wir waren zu viert und kamen zügig hinunter. Ich schaute noch auf meine Sauerstofflasche und drehte noch mehr Sauerstoff auf… wenn ich schon nichts zu trinken hatte, dann wenigstens Sauerstoff. Dass die Kehle damit noch trockener wird, lernte ich auf die harte Tour.
So schmerzhaft und anstrengend jeder Schritt war – es ging voran und ca. 2 Stunden später waren wir auf dem Gletscher unten, den es noch zu queren galt. Jeder für sich liefen wir an einem Grad von Erschöpfung, den ich mir nie im Leben vorstellen konnte. Ich lerne hier, meine Grenzen noch sehr viel weiter nach vorne zu verschieben, als ich es jemals für möglich gehalten hatte.
Dann kam die Rettung. Unser Sherpa sah uns beim Abstieg und kam uns mit Tee und 6 Dosen Coca Cola entgegen. Es war als wäre ein Engel vom Himmel gekommen. Ich habe mich noch nie so sehr darüber gefreut, jemanden zu sehen wie unseren Koch in diesem Moment mit ein paar Dosen Cola in der Hand. Er gratulierte uns herzlich und gab uns jedem eine Cola.
Ich habe noch nie im Leben etwas so Gutes getrunken, wie diese Cola. Ich hatte so unglaublich viel Durst, war so wahnsinnig dehydriert und litt seit Stunden und so war jeder Schluck von diesem Getränk pure Freude. Es war wieder so ein kleiner Moment Glück, den ich auf einem Gletscher unter dem Mt. Everest in einer Dose Cola fand.
Wer hätte hier danach gesucht? Ich habe diesen Moment Glück hier gefunden und er dauerte sogar etwas länger… ich war in dem Moment glücklich wie schon lange nicht mehr! Die Lebensgeister kamen wieder in den Körper und ich war von ganzem Herzen glücklich, diesen Moment erleben zu dürfen.
Bis zum Advanced Basecamp brauchten wir noch eine Stunde und obwohl keine Sauerstoffmaske mehr notwendig gewesen wäre, behielt ich die Sauerstoffmaske an und saugte jeden Liter Sauerstoff aus der Flasche, bis wir im Lager angekommen waren.
Noch nie im Leben war ich so erschöpft und müde, wie in diesem Moment. Was allerdings noch beeindruckender war: Es war nicht Mitternacht, sondern 14 Uhr am Nachmittag. Wir brauchten nur ca. 8 Stunden vom Gipfel bis ins Basislager und das war ein Rekord! Lukas, der Veranstalter, sagte uns, dass er noch nie gehört hätte, dass jemand so schnell wieder im Lager herunten war. Möglich war das, weil wir früh oben waren und dann ohne Verzögerungen als kleines schlagfertiges Team schnell absteigen konnten.
Gegenseitig halfen wir uns, aus den schweren Schuhen zu kommen und anschließend versuchten wir etwas zu essen. Wir reflektierten das Erlebte und waren in diesem Moment dankbar, dass alles so gut verlaufen ist. Wir versuchten am Nachmittag etwas zu schlafen. Obwohl der Körper aber so erschöpft war, wirkte das Koffein aus mehreren Dosen Cola, die ich getrunken hatte, sehr effizient. Ich war fix und fertig – fand aber keinen Schlaf.
Die Sherpas würden die nächsten Tage noch hierbleiben und noch einmal aufsteigen, um einige Sachen und den Müll aus den oberen Lagern herunterzuholen. Weil wir sie also nicht mehr sehen würden, verteilten wir die Trinkgelder noch an diesem Abend und verabschiedeten uns von unserem Team, welches all das möglich gemacht hat.
Ohne Sherpas wäre ein kommerzieller Betrieb am Everest unmöglich – was diese Männer leisten, kann man sich kaum vorstellen. Es sind außergewöhnlich starke Menschen mit einem grossartigen Charakter. Sie reden wenig, arbeiten hart, sind immer da, wenn man sie braucht und sind immer hilfsbereit. Sie verdienen den größten Respekt für das, was sie leisten!

Wir verbrachten die letzte Nacht auf 6.400m im Advanced Basecamp, bevor wir uns auf den 22km langen Abstieg über die Gletschermoränen und das Tal hinaus zum Basislager machten. Während dem Abstieg war ich froh, dass wir diesen langen Hatsch nur einmal machen mussten. Normalerweise steigt man alleine zur Akklimatisierung 2 mal bis zum Nordsattel auf und geht wieder ins Basislager, um sich zu erholen.
Wir machten praktisch die erste Tour zur Akklimatisierung zuhause und die 2. Tour in Nepal am Mera Peak. Somit verbrachten wir insgesamt nur 2 Wochen in Tibet und waren nach nur 9 Tagen am Gipfel – auch das war rekordverdächtig.
Puristen am Berg halten nichts davon, aber ich bin kein Profi und kein Purist. Ich habe mich nur für ein Abenteuer eingeschrieben, ich bin ein Risiko eingegangen und wurde belohnt. Ich konnte den Everest auf eine Art erleben, wie es seit der Kommerzialisierung des Berges nur ganz wenigen Menschen vergönnt war und dafür bin ich wirklich dankbar!
Wir kamen am frühen Nachmittag im Basislager an und dann ging alles sehr schnell. Die Yacks kamen mit unserem Gepäck auch dicht hinter uns ins Lager und ein paar Stunden später saßen wir schon im Auto und fuhren in ein Hotel, das auf der Strecke lag und etwa 4 Stunden weit entfernt war.
In diesem Hotel gab es noch einmal eine Überraschung, denn ich fand wieder ein wenig Glück in einer Dusche. Wie man sich vorstellen kann, gibt es am Berg keine Möglichkeit zu duschen oder sich zu waschen. Da man in der dünnen Luft nicht viel riechen kann, stört das auch nicht weiter, aber wenn man nach 9 Tagen ohne Dusche in ein Hotel kommt und das warme Wasser einschalten kann, ist das für einen Moment lang pure Glückseligkeit.
Am Tag darauf fuhren wir dann zur Grenze nach Nepal und wurden von einem Helikopter abgeholt und nach Kathmandu gebracht. Dort trafen wir im Hotel auf Mitglieder der anderen Teams und eigentlich hatte ich die Idee, alle in einen Club einzuladen und den Erfolg zu feiern. Ich wollte alle zum Essen einladen und hatte anschließend in einem der Top 50 Clubs weltweit einen großen Tisch reserviert, um eine Party zu feiern, wie man es halt gewohnt ist, wenn man mich kennt.
Ich setzte mich also kurz zu den anderen dazu und wollte zuhören, was sie zu erzählen hatten, um sie dann einzuladen. Sie redeten alle nur über Leichen, die sie gesehen haben, einer erzählte, wie er noch jemandem versuchte das Leben zu retten, bevor er vor seinen Augen verstarb und so wie so ging es nur ums Drama… ich stand auf und ging.
An der Reception traf ich einen Kameraden, der dasselbe berichtete. Er traf jemanden vom anderen Team, der vom Drama redete und ich sagte nur: «Lasst uns sofort gehen – ich will nichts davon hören. Wir feiern allein!»
Wir haben keine Leichen gesehen und wir hatten kein Drama. Wir hatten ein perfektes Erlebnis am Berg und ich wollte nichts von dem Drama wissen. Ich bin auf der Nordseite aufgestiegen, weil ich nichts von all dem wissen wollte, was auf der Südseite passierte und das soll auch so bleiben! Sie waren alle wie traumatisiert und redeten von nichts anderem – nein – so sollte mein Erfolg nicht gefeiert werden!
An dem Abend feierten wir für uns. Wir hatten gutes Essen und gingen anschließend in den Club feiern. Der Clubbesitzer ehrte uns mit unseren Bildern vom Gipfel auf den großen Bildschirmen im Club und wir rauchten eine Shisha. Es war eine ausgelassene Feier, mit der wir unseren Erfolg am Berg ausklingen ließen.
Die Müdigkeit setzte dann auf der Heimreise ein. Es ist eine unglaubliche Müdigkeit, die über Wochen anhielt. Bei mir dauerte es fast 4 Wochen, bis ich wieder normal in einen Tag starten konnte. Man fordert vom Körper echt viel ab und ich kann kaum verstehen, wie jemand nach dem Everest direkt wieder normal arbeiten gehen kann – ich konnte 10 Stunden schlafen, Frühstücken und direkt wieder 3 Stunden schlafen, etwas essen und am Nachmittag wieder 3 Stunden schlafen. Das ging 2 Wochen lang so, bis es langsam weniger wurde und es zeigt, wie anstrengend so eine Tour für den Körper ist.
Ich habe auf dem Abenteuer gelernt, meine persönlichen Grenzen zu verschieben. Ich kann viel mehr, als ich denke und bin zu viel mehr in der Lage als ich geglaubt hab. Ich habe Glück unter dem Gipfel, in einer Dose Cola und einer Dusche gefunden und ich bin von ganzem Herzen dankbar, dass alles so gut verlaufen ist.
Mein Erlebnis am Everest war perfekt, was auch der Grund ist, dass ich das nicht noch einmal machen werde. Ich glaube auch nicht, dass ich irgendwo noch etwas Glück, das für mich bestimmt war, übersehen habe…
…die Suche nach meinem Glück wird also woanders weiter gehen.
Ein Besonderer Dank möchte ich an Lukas Furtenbach und sein Team richten. Wenn man große Abenteuer erleben möchte, ist man beim Team Furtenbach an der richtigen Adresse. https://www.furtenbachadventures.com/
Ein weiterer Dank möchte in an meinen Coach, Martin Zohr richten, der mich bestens auf dieses Abenteuer vorbereitet hat. https://www.martinzhor.com/
Und der größte Dank geht an das Sherpa Team, das in diesen Tagen so unglaublich hart und unermüdlich daran gearbeitet hat, dieses einzigartige Abenteuer zu ermöglichen.
Unsere Geschichte wird im 2. Teil der SRF Dokumentation “Wahnsinn am Everest” erzählt:
Es wird auch schön gezeigt, wie andere Teams unterwegs waren und es gibt exklusives Bildmaterial von unserem Aufstieg, das mein Teampartner gemacht hat. Ich bin immer der mit dem weißen Rucksack ab der ca. 20. Minute.
Klick HIER zur SRF Doku auf Youtube

Ein paar Anmerkungen möchte ich noch machen, weil man immer wieder auf Kritik stößt. Ein Kritikpunkt ist der Müll auf dem Berg. Dazu kann ich sagen, dass ich und mein Team garantiert nicht mehr als unsere Spuren im Schnee hinterlassen haben. Die Chinesen legen darauf großen Wert und haben an ausländische Expeditionen sehr hohe Anforderungen. Wer sich nicht dranhalten würde, bekäme keine Permits mehr, um weitere Expeditionen durchzuführen.
Auch was den Müll auf dem Südsattel in Nepal angeht, von dem die Medien oft berichten. Erstens wird davon der meiste Müll hinterher eingesammelt und wieder heruntergebracht und zweitens muss man es relativieren. Selbst wenn etwas zurückbleibt, ist das eine sehr kleine Fläche auf dem Berg. Googelt man mit Google Earth und Streetview an 10 X-Beliebigen Punkt nach Indien hinein, wird an jedem 2. Ort, auf jedem Bild, mehr Müll auf- und neben der Straße liegen sehen, wie auf dieser kleinen Fläche dort oben in der Todeszone – und Indien ist groß!
Für jemand, der auf dem Sofa zu Hause sitzt, ist es leicht irgendwelche populistischen Aussagen, basierend auf einem Titelbild aus der Zeitung, zu machen. Mit der Realität hat das allerdings wenig zu tun. Auch was die Arbeit der Sherpas angeht – es sind hart arbeitende Bergführer, wie es sie in den Alpen zu tausenden auch gibt. Sie bringen reiche Ausländer auf die Berge – so ist das schon seit hunderten Jahren in den Alpen der Fall.
Auch jeder andere Kritikpunkt ist ähnlich. Was hat es jemand auf dem Sofa in Europa zu kümmern, wo ich im Himalaya auf welche Art und Weise ein paar Spuren im Schnee hinterlasse? Mind your own Business…. kümmere Dich lieber um Dein eigenes Geschäft!
Das ist meine Aussage an alle, die z.B. auch die Dokumentation vom SRF mit allerhand primitiven Kommentaren bestückt haben.